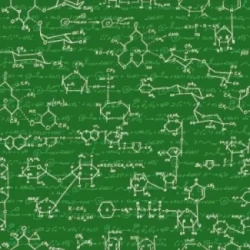Allgemeines
Eine Fettstoffwechselstörung ist an einer veränderten Zusammensetzung der Blutfette (Dyslipidämie) erkennbar. Häufig wird der Begriff im Zusammenhang mit erhöhten Werten von Cholesterin und Neutralfetten (Triglyceriden) gemeint. Diese findet man vor allem bei Übergewicht und Adipositas und einer Zuckerkrankheit (Diabetes) und bedeuten ein erhöhtes Risiko für Herzkreislaufkrankheiten, wie Herzinfarkt und Schlaganfall.
Eine Beeinflussung des Fettstoffwechsels mit besonders niedrigen Fettwerten im Blut ist jedoch auch bei Unterernährung und hormonellen Störungen, wie einer Hyperthyreose, zu finden.
Hier wird auf Stoffwechselstörungen mit erhöhten Fettwerten, die Hyperlipidämie, eingegangen. Sie ist i. d. R. mit einer Hyperlipoproteinämie gleichzusetzen (Kurzinfo dazu hier).
Ursachen
- Genetik: Fettstoffwechselstörungen können erworben oder genetisch bedingt sein. Die erworbene, sekundäre Form lässt sich auf ungesunde Ernährung und mangelnde körperliche Bewegung zurückführen.
- Diabetes: Eine besondere Bedeutung kommt dem Diabetes mellitus zu, der beim Typ II zwar eine genetische Grundlage hat, aber durch ungesunde Ernährung vorzeitig manifest wird.
- Alkohol: Fettstoffwechselstörungen finden sich auch bei Bedingungen wie Alkoholabusus, Niereninsuffizienz, Hypothyreose, primär biliäre Cholangitis und bei anderen chronischen Erkrankungen mit Gallestau (Cholestasen).
- Medikamente: Fettstoffwechselstörungen können Nebenwirkungen von Medikamenten sein. Beispiele: Betablocker, Retinoide, Thiazid-Diuretika, Östrogene (Antikonzeptiva).
- Kaffee: Kaffee enthält Diterpene, die den Cholesterinspiegel im Blut etwas erhöhen können. Skandinavischer Aufguss ist in dieser Beziehung riskant, wohingegen Papierfilter die aktiven Inhaltsstoffe weitgehend zurückhalten (siehe hier).
- Kohlenhydratreiche Ernährung: Eine kohlenhydratreiche Ernährung kann Ursache erhöhter Triglyzeride im Blut (Hypertriglyzeridämie) sein.
→ Blutfette
→ Hyperlipoproteinämie
Adipokine
Adipokine sind Fettgewebshormone. Unter ihnen haben vor allem Leptin und Adiponectin eine besondere Bedeutung.
- Leptin informiert das Gehirn über den Ernährungszustand des Körpers und senkt das Hungergefühl. Bei sehr übergewichtigen Menschen entwickelt sich eine Leptinresistenz, sodass die Rückkopplung vermindert ist. Auch wurden „loss of function“-Mutationen von Leptin und des Leptinrezeptors gefunden, die die Rückkopplung stören. Die resultierende Hyperphagie („Fresssucht“ bei Versuchstieren) ist assoziiert mit erhöhten Blutfetten. 1 Umgekehrt ist ein erhöhter Leptinspiegel im Blut mit niedrigeren Blutfetten assoziiert. 2 Zu Leptin siehe hier.
- Adiponectin ist ein Fettgewebshormon, welches den Fettsäureabbau in der Leber und die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse stimuliert, die Glukoneogenese in der Leber unterdrückt und antioxidativ wirkt. Genetische Defekte von Adiponectin (geprüft 3 Polymorphismen) sind nicht mit erhöhten Blutfetten und einem erhöhten Arterioskleroserisiko korreliert 3. Vielmehr wird es als ein antiatherogener Faktor angesehen. Die Adiponectinrezeptoren finden sich in hoher Dichte in Herzmuskelzellen und in den Endothelzellen der Blutgefäße und spielen bei der Entstehung einer Arteriosklerose eine Rolle. Bei Artreiosklerosepatienten ist der Adiponectinspiegel deutlich erniedrigt. 4 Zu Adiponectin siehe hier.
Krankheiten mit Fettstoffwechselstörungen
Metabolisches Syndrom und Zuckerkrankheit
Beim metabolischen Syndrom werden erhöhte Fettwerte im Blut gefunden. Eine Hyperlipidämie ist Bestandteil des metabolischen Syndroms. Bei ihm wie auch beim Diabetes Typ 2 sind die Stoffwechselstörungen in erster Linie Folge einer erhöhten peripheren Insulinresistenz. 5 6 Auch eine Leptinresistenz von Körperzellen kann eine verstärkende Rolle spielen. 7 8
Adipositas
Adipositas, insbesondere ein erhöhter Bauchumfang, ist mit einer Hyper- und Dyslipidämie verbunden, und über sie mit einem erhöhten Risiko für eine Arteriosklerose.
Ein wichtiger Grundstein für ein Übergewicht des Kindes mit einer frühkindlichen Fettstoffwechselstörung ist eine falsche Ernährung der Mutter. Ihre Überernährung schlägt sich in einer Veränderung der Genaktivitäten nieder, die epigenetisch an das werdende Kind weitergegeben wird 9 10 11
Eine angeborene Adipositas ist das Alström-Syndrom. Es manifestiert sich mit einer Hyperlipidämie plus einem Herz-, Nieren- und Gehirnschaden und mit schwerer peripherer Insulinresistenz. 12
Arteriosklerose
Fettstoffwechselstörungen mit Hyperlipidämie sind starke Risikofaktoren für eine vorzeitige Arteriosklerose. Durch sie ist auch das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und für Durchblutungsstörungen der Beine (periphere arterielle Verschlusskrankheit, paVk) und innerer Organe (Darmischämie; Ortner´sche Claudicatio intestinalis) erhöht. Um das Arterioskleroserisiko zu minimieren, haben die Fachgesellschaften strenge Leitlinienvorgaben erarbeitet. Dazu siehe hier. 13 14
Das Behandlungsziel bei sehr hohem Risiko einer koronaren Komplikation ist beispielsweise LDL-C von < 1,8 mmol/l (70 mg/dl) oder eine Senkung um mindestens 50 %, wenn der LDL-C-Ausgangswert zwischen 1,8 und 3,5 mmol/l (70 und 135 mg/dl) liegt. 15
Nephrotisches Syndrom
Im Rahmen eines nephrotischen Syndroms treten erhöhte Blutfettwerte mit Hypercholesterinämie und erhöhten Triglyceridwerten auf. Dazu siehe hier.
Schilddrüsenunterfunktion
Bei der Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) finden sich typischerweise erhöhte Lipidwerte im Blut. Dazu siehe hier.
Polyzystisches-Ovar-Syndrom
Das polyzystische Ovar (Stein-Leventhal-Syndrom) ist durch mehrere Zysten in den Ovarien (nicht immer nachweisbar), Unfruchtbarkeit, eine unregelmäßige Periode, erhöhte Androgenspiegel, Hirsutismus (vermehrte Körperbehaarung) und oft vorliegender Hyperlipidämie gekennzeichnet. Es besteht eine koronaren Herzkrankheit und ihre Komplikationen 16.
Diagnostik
Zur Einteilung der Fettstoffwechselstörungen wurde früher vielfach das Schema nach Fredrickson verwendet. Heute werden die Lipoproteine, wie HDL und LDL, einzeln bestimmt.
Für eine Abschätzung des kardiovaskulären Risikos ist die Bestimmung von Non-HDL-Cholesterin, Lipoprotein (a) und Apo-B besonders aussagekräftig. In der Praxis von Bedeutung werden am häufigsten Gesamtcholesterin (TC, totales Cholesterin), LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyceride (TG) bestimmt. Die Bestimmung erfolgt in Nüchternblut.
Indikationen
Menschen mit engen Blutsverwandten, die ein metabolisches Syndrom oder Diabetes haben, sowie Frauen mit übergewichtigen Kindern bei der Geburt sollten hinsichtlich Blutfettwerten und einer gestörten Glukosetoleranz untersucht werden.
Eine genetische Untersuchung ist angebracht, wenn eine Fettstoffwechselstörung nicht ausreichend auf Medikamente reagiert und mehrere Familienmitglieder betroffen sind. Ist dies schon bei einem Kind der Fall, kann es sich beispielsweise um eine (sehr seltene) genetisch bedingte Lipoproteinlipase-Defizienz handeln. Sie kann durch Genanalyse diagnostiziert werden, und bedarf einer intensiven Therapie (siehe unter Hypertriglyceridämie).
Bei Nieren-, Pankreas- und Leberkrankheiten können Fettstoffwechselstörungen auftreten, sodass deren Überwachung eine gelegentliche Überprüfung der Blutfettwerte beinhaltet.
Therapie
Die Behandlung einer Fettstoffwechselstörung richtet sich nach der Ursache und dem Typ.
- Zur Reduktion des LDL-Cholesterins (und Erhöhung von HDL) kommen Fibrate (wie Bezafibrat, Fenofibrat oder Gemfibrozil), Statine (wie Simvastatin) und Cholesterin-Resorptionshemmer (wie Ezetimib) infrage.
- Zur Senkung der Triglyceride und Erhöhung des HDL kommen Fibrate (wie Bezafibrat) und Nikotinsäure (Niacin) infrage.
- Zur Senkung der Triglyceride sollte der Beitrag einer vermehrten Kohlenhydratzufuhr in der Ernährung eruiert werden. Im gegebenen Fall ist eine Senkung ihres Anteils erforderlich (Diätberatung).
→ Therapie der Hyperlipoproteinämie
→ Fettsenker
Bei einer extrem seltenen familiären Form der Hypertriglyceridämie, die auf herkömmliche Therapiemaßnahmen nicht ausreichend reagiert, kann ein genetischer Lipoproteinlipase-Mangel vorliegen. Bei ihm kommt prinzipiell eine Gentherapie in Betracht. Dazu wurde Alipogene tiparvovec (Glybera®) entwickelt. Es ist allerdings extrem teuer („million dollar drug“) und inzwischen zurückgezogen worden (siehe hier).
→ Auf facebook informieren wir Sie über Neues und Interessantes!
→ Verwalten Sie Ihre Laborwerte mit der Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion.
Verweise
Weiteres
- Curr Diabetes Rev. 2014 Mar;10(2):131-45. doi: 10.2174/1573399810666140508121012. [↩]
- BMJ Open. 2019 Nov 7;9(11):e026860. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-026860[↩]
- Clin Endocrinol (Oxf). 2011 Feb;74(2):214-22. doi: 10.1111/j.1365-2265.2010.03902.x.[↩]
- Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Apr 26;13:821028. DOI: 10.3389/fendo.2022.821028.[↩]
- Curr Cardiol Rep. 2006 Nov;8(6):427-32. doi: 10.1007/s11886-006-0100-4[↩]
- Diabetes Metab. 2003 Sep;29(4 Pt 2):6S19-27. doi: 10.1016/s1262-3636(03)72784-0[↩]
- Cytokine. 2019 Sep;121:154735. doi: 10.1016/j.cyto.2019.154735[↩]
- Curr Hypertens Rep. 2008 Apr;10(2):131-7. DOI: 10.1007/s11906-008-0025-y.[↩]
- Epigenomics. 2015;7(1):85-102. doi: 10.2217/epi.14.71[↩]
- Epigenetics. 2019 Mar;14(3):215-235.[↩]
- Nutrients. 2024 Oct 16;16(20):3502. doi: 10.3390/nu16203502[↩]
- Clin Dysmorphol. 2013 Jan;22(1):7-12. doi: 10.1097/MCD.0b013e32835b9017[↩]
- Leitlinien der DGK, siehe unter AWMF[↩]
- Leitlinie Sekundärprophylaxe Schlaganfall, siehe unter AWMF[↩]
- DGK-Pocket Giudelines 2016[↩]
- Endocr Rev. 2012;33:812–41. doi: 10.1210/er.2012-1003[↩]