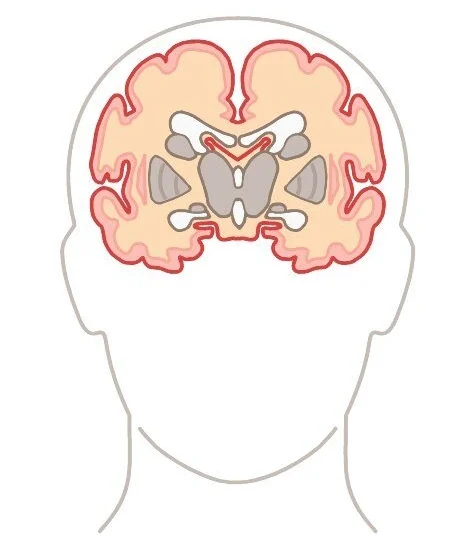Xenon (Xe) ist ein Edelgas, das seit einigen Jahren wegen seiner anästhetischen und neuroprotektiven Wirkungen medizinisches Interesse erlangt hat. Es beeinflusst Prozesse sowohl an der Zellmembran als auch in der Zelle, die das Überleben der Zellen fördern 1 2.
Xenon wird über die Lunge aufgenommen und mit dem Blut transportiert. Wegen seiner Fettlöslichkeit wird es von Fettgewebe gut aufgenommen. Über vielfältige Mechanismen wirkt es anästhetisch und organoprotektiv. Während die anästhetische Wirkung keine Vorteile gegenüber den bereits in Gebrauch befindlichen Anästhetika aufweist, kann die organoprotektive und speziell die neuroprotektive Wirkung trotz des hohen Preises von therapeutischem Interesse sein, insbesondere auch wegen der fehlenden Nebenwirkungen 3 4.
Xenon als Anästheticum
Die Wirkung von Xe als Narkosemittel (Anästhetikum) beruht auf einer Hemmung spezieller Rezeptoren im Gehirn (Hemmung von NMDA-evozierten Potenzialen und der NMDA-Rezeptoren (Rezeptoren für N-methyl-D-aspartate) an den glutaminergen Synapsen des Hippocampus 5 sowie synaptischer AMPA-Rezeptoren im präfrontalen Cortex und der Substantia gelatinosa 6 (Erklärung.: NMDA = N-methyl-d-aspartate; AMPA = alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid)). Ab einer Konzentration von 50 % in dem Beatmungsgasgemisch kommt eine Anästhesie zustande. Xe ist zwar teuer, hat aber den Vorteil, keine Nebenwirkungen aufzuweisen.
Xenon zur Neuroprotektion
Xe ist ein NMDA-Rezeptorantagonist, was seine neuroprotektive Wirkung begründet 5. NMDA-Rezeptoren vermitteln über einen Kalziumeinstrom in die Zelle und eine dadurch ausgelöste Kaskade von biochemischen Vorgängen schließlich den Zelltod (Apoptose). Dies kann beispielsweise unter folgenden Bedingungen stattfinden:
- bei einer während der Geburt stattfindenden Sauerstoffuntersättigung des Gehirns (durch Asphyxie),
- beim Ertrinken,
- in Randgebieten eines Schlaganfallbezirks,
- während Operationen am Herzen oder
- bei einem Schädelhirntrauma.
Eine Hemmung der NMDA-Rezeptoren durch Xe verhindert dies und reduziert die Verschlimmerung der Hirnschädigung in in-vitro- und in-vivo-Modellen 7 8.
Xe reduziert bei Mäusen das geschädigte Areal nach einer traumatischen Hirnverletzung 9.
Der postoperative Schmerz lässt sich im Tierversuch durch eine einzige Xe-Dosis kurzfristig und bei mehreren Behandlungen langfristig verbessern. Als ein Mechanismus wurde die Hemmung der Aktivierung der Mikroglia identifiziert 10.
Xenon zum Schutz vor Hirnschäden unter der Geburt
In Tierexperimenten weist Xe eine signifikante Kurzzeit-Neuroprotektion in neugeborenen Ratten nach einer zerebralen Ischämie und Hypoxie auf; in der Xenon-Gruppe fand sich eine Reduktion der Hirnschädigung von über 80 % in verschiedenen Hirnarealen. Daher wurde Xenon als idealer Kandidat zur Sofortbehandlung bei perinataler Hypoxie angesehen 11.
Xenon-Anästhesie bei Herzoperationen
Xenon wirkt kardioprotektiv. Am Beispiel risikoreicher kardialer Operationen wurde gezeigt, dass Xenon das Risiko postoperativer Delirien reduziert; es lag 4,2-fach geringer als mit Sevofluran. Auch benötigten Patienten unter Xenon signifikant weniger Noradrenalin zur Aufrechterhaltung eines gewünschten Blutdrucks 12. In anderen Untersuchungen ließ sich zeigen, dass Xe zudem entzündungsfördernde (proinflammatorische) Auswirkungen kardialer Operationen fördert (z. B. 3-fach höherer Anstieg von Interleukin 6, IL6) und antientzündliche Effekte unterdrückt. Es bleibt zu klären, ob und welche klinischen Auswirkungen daraus folgen 13.
Xenon zur Nierenprotektion (Renoprotektion)
Eine akute Nierenschädigung durch Ischämie (experimentell im Ischämie-Reperfusion-Modell) kann durch Xenon unterdrückt werden 14. Eine akute Nierenschädigung durch Lipopolysaccharide (Endotoxine von Bakterien), wie sie im Rahmen einer Sepsis auftreten kann, wird durch Xe ebenfalls gemildert oder unterdrückt. Dies erfolgt durch eine Hochregulation von miR-21 in den Nieren, was schließlich zu einer Abnahme der Apoptoseaktivität führt 15.
Xenon zum Schutz vor der Caisson-Krankheit bei Tauchern
Nach einem Tieftauchgang muss das Auftauchen nach Schema langsam und mit Pausen erfolgen, um die Caisson-Krankheit (decompression sickness) zu vermeiden. Bei zu raschem Auftauchen kommt es zur Bildung von Stickstoffblasen im Nervengewebe mit akuten neurologischen Schäden. Diese Schäden sind zum großen Teil durch eine durch diese Bläschen akut unterbrochene Blutzufuhr zu kleinen Arealen des Gehirns und des Rückenmarks bedingt. Als Zeichen der mangelhaften Sauerstoffversorgung wird Laktatdehydrogenase (LDH) freigesetzt. Xenon vermag solche Nervenschäden zu minimieren. Untersuchungen zeigen, dass die LDH-Freisetzung durch Xenon, wenn es direkt nach dem Auftauchen verabreicht wird, signifikant reduziert wird 16.
Xenon und Doping
Die World Anti-Doping Agency (WADA) hat am 1.9.2014 Xenon auf die Liste gebannter Dopingmittel gestellt. Als Substanz, die endogene Hypoxie-induzierbare Faktoren aktivieren kann (es ist ein „hypoxia-inducible factor 1a (HIF-1a) activator“), vermag Xenon gegen Sauerstoffmangel unempfindlicher zu machen und Hypoxieschäden, wie sie bei Extremsport auftreten können, zu mildern. Nach einer Xenonbehandlung steigt der Erythropoetinspiegel. Xe ist bis 40 Stunden nach einer Xenon-Anästhesie mithilfe der Gaschromatographie/Massenspektroskopie im Urin nachweisbar 17.
→ Auf facebook informieren wir Sie über Neues und Interessantes!
→ Verwalten Sie Ihre Laborwerte mit der Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion.
Verweise
Weiteres
- Intensive Care Med Exp. 2020 Feb 24;8(1):11. doi: 10.1186/s40635-020-0294-6[↩]
- Front Neurosci. 2023 Jul 14;17:1225191. doi: 10.3389/fnins.2023.1225191[↩]
- Maze M1. Can J Anaesth. 2015 Oct 27. [Epub ahead of print][↩]
- Med Gas Res. 2013 Feb 1;3(1):4. doi: 10.1186/2045-9912-3-4.[↩]
- Nature. 1998 Nov 26;396(6709):324[↩][↩]
- Anesthesiology. 2009 Dec;111(6):1297-307[↩]
- Crit Care. 2010;14(4):229. doi: 10.1186/cc9051[↩]
- Mol Neurobiol. 2020 Jan;57(1):118-124. doi: 10.1007/s12035-019-01761-z[↩]
- Crit Care Med. 2015 Jan;43(1):149-158. doi: 10.1097/CCM.0000000000000624[↩]
- PeerJ. 2024 Feb 19;12:e16855. doi: 10.7717/peerj.16855.[↩]
- Stroke. 2006 Feb;37(2):501-6[↩]
- Br J Anaesth. 2015 Oct;115(4):550-9[↩]
- Crit Care. 2015 Oct 15;19:365. doi: 10.1186/s13054-015-1082-7[↩]
- Anesthesiology. 2013 Sep;119(3):621-30[↩]
- Crit Care Med. 2015 Jul;43(7):e250-9[↩]
- Sci Rep. 2015 Oct 15;5:15093. doi: 10.1038/srep15093.[↩]
- Rapid Commun Mass Spectrom. 2015 Jan 15;29(1):61-6[↩]