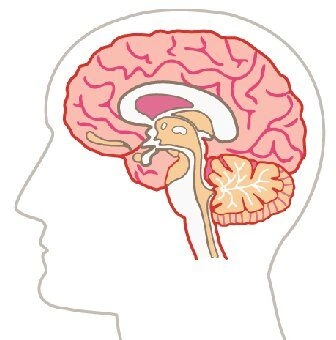Intelligenz ist eine komplexe geistige Fähigkeit, die hilft, Probleme des Lebens zu erkennen, einzuordnen und zu bewältigen, sich im eigenen Lebensraum einzurichten und die Lebensbedingungen für sich optimal zu gestalten. Ein Wesenszug der Intelligenz ist es, aus Erfahrung lernen zu können. 1 Intelligenz beinhaltet kognitive Funktionen wie Erkennen, Aufmerksamkeit, Sprache und Planen. Alle diese Funktionen können standardisiert getestet werden. Die Ergebnisse korrelieren in etwa mit beruflichem Fortkommen, Gesundheit und Lebenserwartung. 2
Evolution der Intelligenz
Intelligenz ist nicht ein Merkmal des Menschen allein; auch verschiedene, nicht direkt miteinander verwandte Tierarten zeigen Intelligenz, so Affen, Elefanten, Wale, Raben, in gewissem Sinne auch Oktopusse 3.
Die Ausprägung einer Intelligenz bei Säugetieren lässt sich durch eine Kombination aus der Anzahl der kortikalen Neuronen, der Neuronenpackungsdichte, dem Abstand zwischen den Neuronen und der axonalen Leitungsgeschwindigkeit ausdrücken. Diese Faktoren bestimmen die allgemeine Informationsverarbeitungskapazität des Gehirns (information processing capacity, IPC). In einer Zusammenstellung wird folgende Reihenfolge der IPC-Werte vorgestellt: Der höchste würde sich beim Menschen finden, gefolgt von Menschenaffen, Altwelt- und Neuweltaffen. Die IPC von Walen und Elefanten läge aufgrund eines dünnen Kortex, einer geringen Neuronenpackungsdichte und einer geringen axonalen Leitungsgeschwindigkeit deutlich niedriger. Raben- und Papageientaucher hätten viele, sehr kleine und dicht gepackte Neuronen in der Rinde, was trotz sehr kleiner Gehirnvolumina ihre hohe Intelligenz erklärt. 4
Hohe Intelligenz hat sich offenbar mehrfach entwickelt. Die Intelligenz ist arttypisch, so dass sie sich zwischen den Arten nicht direkt vergleichen lässt. Innerhalb der Wirbeltiere und speziell der Mammalia (Säugetiere) hat der Mensch bezüglich der Intelligenz jedoch eine herausragende Stellung. Sie lässt sich mit einer besonders hohen kortikalen Neuronendichte und Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung assoziieren. 5 Zudem spielt die Erlangung der Sprachfähigkeit eine fördernde Rolle. 6
Eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Intelligenz sollen die Notwendigkeiten gespielt haben, mit Bedrohungen von außen fertig zu werden, und kooperative soziale Interaktion für die Gruppe zu entwickeln. Eine bisher unterschätzte Rolle soll die Anforderung gespielt haben, mit Gruppenaußenseitern, die Fortpflanzungskonkurenten darstellen, so umzugehen, dass dies für die Gruppe günstig ausfällt. Diesem Punkt wird eine hohe evolutionäre Bedeutung zugesprochen. Alle diese Anforderungen erfordern ein hohes Maß an Erinnerungs-, Differenzierungs- und Urteilsvermögen, alles Fähigkeiten einer Intelligenz. 7
Fähigkeiten der Intelligenz
Intelligenz beruht auf vielen sehr verschiedenen Fähigkeiten des Gehirns, so dem Sprach-, Erkennungs-, Lern-, Erinnerungs-, Abstraktions-, räumlichen und zeitlichen Orientierungs-, Vorausschau-, Planungs-, Rechen- und Empathievermögen. Auch die künstlerische und musikalische Begabung ist eine Form der Intelligenz.
Um Intelligenzleistungen abrufen zu können, bedarf es eines Interesses sowie einer Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit (Fähigkeit, sein Interesse zu fokussieren und es über einen ausreichenden Zeitraum aufrecht zu erhalten). Auch eine gewisse Impulskontrolle (Kontrolle und Abwehr von Überaktivität, Ablenkbarkeit, Scheu und Vermeidungsverhalten) ist dazu erforderlich.
Die verschiedenen Fähigkeiten, die zur Intelligenz beitragen, überlappen sich mehr oder weniger stark. Lernen und Erinnern (Gedächtnis) sind Grundfähigkeiten. Andere Fähigkeiten, wie Erkennen, Vorausschauen und Planen setzen Erinnern voraus. Das Mit- und Nachempfindensvermögen (Empathie) ist relativ eigenständig, hat aber auch Verbindungen zum Erinnern. Das Orientierungsvermögen basiert wesentlich auf räumlichem Denken, Zeitgefühl und Gedächtnis.
Entscheidungsfindung: Verflechtung der Intelligenz mit weiteren Fähigkeiten
Wie Entscheidungen getroffen werden, ist ein komplexer Prozess, der von der Intelligenz beeinflusst wird. Offenbar spielen in vielen Situationen neben logischem Denken weitere Eigenschaften dabei eine Rolle, wie kognitive Fähigkeiten, die Bereitschaft Risiken einzugehen, sowie die Emotionalität. Die Zusammenhänge werden mit „Gambling Tasks“ (Entscheidungsfindung in Spielaufgaben, z. B. Cambridge Gambling Task) bei Erwachsenen und Kindern erforscht. In diesen Situationen spielen Erwartungen von Belohnung und Verlust eine entscheidende Rolle, so dass Intelligenz-getriebene rein rationale Entscheidungen meist nicht getroffen werden. 8
Die Fähigkeit zu Entscheidungsfindungen interagieren laut MRI-Untersuchungen mit kognitiven (linker dorsaler anteriorer „cingulate cortex“, dACC) und sozialen Kontrollmechanismen (rechter oberer Sulkus des Temporallappens). 9
Einzelne Entscheidungen werden durch Abwägung von Nutzen und Risiko beeinflusst, offenbar analog der Kriterien einer räumlichen Orientierung. Für die räumliche Orientierung sind spezielle Gehirnzellen (Neuronen des Hippocampus) zuständig, die jedem Punkt / Gegenstand einen Wert in einer fiktiven kognitiven Landkarte zuordnen. Dieses Prinzip wendet unser Gehirn offenbar auch bei nicht-räumlichen Entscheidungsfindungen an: Es ordnet auch abstrakte kognitive Inhalte in einen abstrakten Werteraum ein, indem es diese über das Belohnungssystem mit Bewertungen (Erwartungen von Belohnungen) versieht. Der Hippocampus (Kern im Temporallappen, Zentrum des limbischen Systems, siehe hier) überträgt sein Prinzip der räumlichen Orientierung auch auf wertbasierte Entscheidungsfindungen. 10
Intelligenztests
Mit Hilfe der Intelligenz werden außerordentlich unterschiedliche Lebensbedingungen bewältigt. Durch Übung werden spezielle Fähigkeiten, die zur Intelligenz zählen, erheblich verbessert. So beherrschen Ureinwohner Papua-Neuguineas die Orientierung in weitem Gelände in einer für Städter nicht nachvollziehbaren Weise; Städter würden mit ihrer „hohen“ Intelligenz dort vollkommen versagen. Herkömmliche Intelligenztests würden diese außerordentliche, dort erforderliche Intelligenz nicht annähernd erfassen können (Beispiel beschrieben in 11 ).
Intelligenztests, die eine Mischung von Tests verschiedener Fähigkeiten darstellen, berücksichtigen eklatante Unterschiede der Lebensbedingungen und der dadurch bedingten unterschiedlichen Übung von Fähigkeiten nicht adäquat und erweisen sich daher als ein nur beschränkt taugliches Mittel, die Intelligenz von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen oder auch nur aus unterschiedlichen sozialen Schichten miteinander vergleichbar zu machen.
Dennoch ist unter Berücksichtigung der unterschiedlich trainierten Fähigkeiten die Bestimmung von Teil-IQ’s (Intelligenzquotienten) weiterhin von Bedeutung, speziell für wissenschaftliche Zwecke. So können beispielsweise ein Performance-IQ und ein verbaler und ein nonverbaler IQ differenziert und verwendet werden, um den Einfluss von Faktoren (z. B. von Alter oder Ausbildung) auf die Entwicklung der Intelligenz und auf Befunde der Hirnforschung festzustellen. 12 13
Differenzierte Intelligenztests sind z. B. folgende 14:
- Untersuchungen nach dem Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS oder WASI). Geprüft werden Allgemeinwissen, Vokabular, sprachliches Schlussfolgern, Lösung von Problemen in neuen Situationen. (WAIS; Wechsler, 1997)
- Untersuchungen nach dem Delis–Kaplan Executive Function System (D–KEFS; Delis et al., 2001). Geprüft werden u. a. verschiedene kognitive Fähigkeiten zur Durchführung von Prozessen (wie Pfadmarkierung, sprachliche Flüssigkeit, Kartensortierung).
Intelligenz oder Intelligenzen?
Es werden die der Intelligenz zugrunde liegenden fundamentalen Strukturen und Mechanismen sowohl des Geistes als auch des Gehirns hervorgehoben.
Vor allem 2 Hypothesen stehen im Raum:
- die Hypothese einer generellen Intelligenz, repräsentiert in einem über das Gehirn verzweigten neuronalen Netzwerk mit einzelnen spezialisierten Arealen, die eine allgemeine Problemlösung mit Anwendbarkeit auf die verschiedensten Aufgaben ermöglicht (Spearman’s „general factor model“, „g“), und
- die Hypothese multipler Intelligenzen, die Problemfeld-typisch in spezialisierten Hirnregionen repräsentiert sind.
Multiple Intelligenzen
Nach Gardner 15 können je nach den zu lösenden Aufgaben verschiedene Fähigkeiten der Bewältigung unterschieden werden:
- Linguistische Fähigkeiten: sie ermöglichen Lesen, Schreiben, sich sprachlich auszudrücken und Sprache zu verstehen.
- Mathematische Fähigkeiten: sie ermöglichen es, mathematische Probleme zu lösen (z. B. wie viele Tage bis zu einem Termin verbleiben, beim Bezahlen das „Rausgeld“ berechnen, das Alter nach dem Geburtsjahr berechnen), logisches Schließen.
- Räumliche Intelligenz: sie ermöglicht es, sich im Raum, einem Territorium oder auf der Landkarte zurechtzufinden oder einen Bauplan zu erstellen.
- Musikalische Intelligenz: sie ermöglicht es, ein Lied zu singen, auf einem Instrument zu spielen oder zu komponieren.
- Fähigkeit der Körperbeherrschung: sie ermöglicht es, sich differenziert und zielgerichtet zu bewegen, z. B. beim Werfen, Tanzen, Schwimmen, Kartoffelschälen.
- Fähigkeit etwas zu erforschen: sie ermöglicht es, Muster (z. B. Gesetzmäßigkeiten in der Natur, Funktionsweise einer Mechanik) zu herauszufinden.
- Zwischenmenschliche Intelligenz: ermöglicht es, andere Menschen in ihrem Ausdruck (Emotionen), Verhalten und ihrer Motivation zu verstehen.
- Fähigkeit, sich selbst zu verstehen: wer wir sind, was wir wollen, welche Motive uns treiben, wie wir uns ändern können.
Weitere Intelligenzen von Bedeutung sind die emotionale und die soziale Intelligenz, die es erlauben, zwischenmenschliche Beziehungen und Gruppenverhalten zu verstehen und sich in diesen Räumen sicher zu bewegen.
Konzept der 3 Schichten der Intelligenz
Nach der CHC-Theorie (Cattell, Horn, Carroll, zitiert in 1 ) werden 3 Schichten der Intelligenz angenommen, die zueinander hierarchisch geordnet sind.
- Schicht I: Fähigkeiten mit eng begrenzter Verwendbarkeit;
- Schicht II: Fähigkeiten unbestimmter Art mit breiter Verwendbarkeit; dazu zählen die Fähigkeiten, mit Neuem umzugehen und rasch und flexibel zu denken;
- Schicht III: Fähigkeiten von allgemeiner Verwendbarkeit, für kognitive Leistungen aller Art von großer Bedeutung. Dazu gehören der Vorrat an allgemeinem und speziellem Wissen sowie das zur Verfügung stehende Vokabular.
Vor allem die Intelligenzfähigkeiten der Schichten II und III sind mit der Fähigkeit, im Leben zurecht zu kommen, assoziiert, so mit Gesundheit, beruflichem Fortkommen und Einkommen.
Theorie von 3 Pfeilern der Intelligenz
Der Grad der Intelligenz richtet sich danach,
- wie effektiv Ziele formuliert und erreicht werden, die man sich im Leben gestellt hat,
- wie effektiv man seine eigenen Stärken einsetzt und seine Schwächen kompensiert,
- ob es gelingt, sich seinem Umfeld anzupassen oder sein Umfeld zu seinen Gunsten zu verändern.
Die dazu erforderliche menschliche Intelligenz beruht nach Sternberg auf 3 Pfeilern („triarchic theory“) 1, der kreativen, der analytischen und der praktischen Intelligenz. Sie wurde erweitert, um Weisheit-basierte Fähigkeiten einzubeziehen.
- Die kreativen Fähigkeiten ermöglichen neue Ideen.
- Die analytischen Fähigkeiten ermöglichen die Beurteilung der neuen Ideen bezüglich gut bzw. günstig oder schlecht bzw. ungünstig,
- Die praktischen Fähigkeiten ermöglichen die Umsetzung der neuen Ideen.
- Die Weisheit-basierten Fähigkeiten ermöglichen die Bewertung der neuen Ideen bezüglich allgemeiner Nützlichkeit unter Einbeziehung ethischer Maßstäbe.
Genetische Grundlagen der Intelligenz
Es werden Beziehungen der Intelligenz zu genetischen Grundlagen angenommen. Studien haben eine familiäre Häufung und Vererbbarkeit intelligenter Fähigkeiten nachgewiesen 16. Genomweite Scans haben eine Assoziation von Intelligenz mit verschiedenen Genen, speziell in Regionen auf den Chromosomen 2q und 14q wahrscheinlich gemacht; allerdings hat sich kein spezielles „Intelligenzgen“ gefunden. 17
Der “brain derived neurotropic factor” BDNF vermittelt eine Plastizität des Gehirns, insbesondere des präfrontalen Cortex, der in besonderer Weise mit Intelligenz verbunden 18 und bei dem eine lebenslange Plastizität nachweisbar ist. Menschen mit einem Val66Met-Polymorphismus (Austausch von Valin gegen Methionin an Position 66 des Polypeptids) sind resistenter gegen einen allgemeinen Intelligenzverlust nach traumatischem Frontalhirnschaden als diejenigen mit einem Val/Val-Genotyp. 19 Auch andere Untersuchungen weisen auf eine Bedeutung des BDNF für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Intelligenz hin. 20 21 22 Eine Verfolgung der Hirnvolumina und der Oberfläche bei eineiigen und zweieiigen Zwillingen und Nichtzwillingsgeschwistern über 5 Jahre erbrachte Hinweise auf eine Vererblichkeit von Hirngröße und ihrer Veränderlichkeit mit der Zeit, sowie eine Assoziation von Hirngröße mit der Intelligenz, die den gleichen Genen zugerechnet wird. 23
An Intelligenz beteiligte Hirnstrukturen
Neue Aspekte kommen von der Hirnforschung, die ein verzweigtes neuronales Netzwerk postuliert. Die Befunde beginnen zu klären, welche Hirnbezirke für welche Intelligenzfunktionen zuständig sind.
Nach der Hypothese der multiplen Intelligenzen beruht die Gesamtintelligenz auf dem Zusammenwirken der Funktionen multipler isolierter Hirnareale. Diese wären
- spezifische temporale und okzipitale Areale des Gehirns zur Verarbeitung sensorischer Informationen,
- parietale Regionen zur sensorischen Integration und Abstraktion,
- frontale Areale für Problemlösung und Schlussfolgerungen,
- das anteriore Cingulum zur Selektion von Antworten und Hemmung automatischer Antworten.
Das frontale und parietale Netzwerk und die zwischen ihnen verlaufenden Verbindungen der weißen Substanz spielen die Hauptrolle dabei.
Als Gegenhypothese wird postuliert, dass es eine zentrale Intelligenz gibt, die für alle Teilfunktionen eine überragende Bedeutung besitzt, indem sie an einer „intelligenten“ Lösung aller komplexen Aufgaben wesentlich beteiligt ist. Eine solche zentrale Intelligenz wird mit einem frontoparietalen neuronalen Netzwerk in Zusammenhang gebracht, das laut fMRI-Befunden bei der Lösung von Problemen der allgemeinen Intelligenz immer rekrutiert wird. 2 14
Untersuchungen an Patienten mit lokalisierten Hirnverletzungen unterstützen diese Hypothese. Eine Störung im Netzwerk frontaler und parietaler Regionen (gleich wo) geht mit einer Störung der allgemeinen Intelligenz einher. Die Untersuchungen zeigen zudem, dass die Ausführung von Abläufen (executive functions) ebenfalls mit einer Aktivierung des frontoparietalen Netzwerks einhergehen. Vermutlich hat die Evolution dieses für die allgemeine Intelligenz zentralen Netzwerks wesentlich zur Evolution des Menschen beigetragen. Ihr Beitrag zur sozialen und emotionalen Kompetenz ist jedoch bisher nicht geklärt. 24
Interessanterweise ist die frontoparietale (präfrontale und parietale) Region in Einstein’s Gehirn ungewöhnlich ausgeprägt gewesen, was als das neuroanatomische Substrat für die bemerkenswerten kognitiven und mathematischen Fähigkeiten sowie das räumliche Vorstellungsvermögen angesehen wird. 25
Kreativität
Kreativität ist eine besondere Intelligenzleistung, bei der eine Idee entwickelt wird, die zu etwas Neuem führt. Als zentral dafür gilt „divergentes Denken“. Durch divergentes Denken (Denken ohne strenge Zentrierung) wird
- im Gedächtnis nach vorhandenem Wissen gesucht, das mit Hilfe einer besonderen Assoziations- und Kombinationsfähigkeit zu neuen Ideen verbunden werden kann.
- nach genuin neuen Ideen gesucht, die durch Gedächtnisinhalte nicht erhalten werden können.
Untersuchungen mit funktioneller Magnetresonanzbildgebung (fMRI) zeigten bei divergentem Denken eine Aktivierung des linkshemisphärischen frontalen Netzwerks, von Teilen des Hippocampus und des unteren Temporallappens sowie eine verminderte Aktivierung der rechten temporoparietalen Verbindung. Die Bildung neuer Ideen war in diesen Untersuchungen assoziiert mit deutlich erhöhter Hirnaktivierung im linken unteren Parietallappen. Diese Bezirke werden bei der zunächst durchgeführten Suche nach alten, eventuell passenden Ideen aus dem Gedächtnis nicht aktiviert, sondern erst dann, wenn genuine neue Ideen entwickelt werden. Der linke untere Parietallappen ist laut früheren Untersuchungen auch bei geistigen Vorstellungen und Planungen besonders aktiv. 26
Soziale Intelligenz
Menschen besitzen die einzigartige Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Sie ist die Grundlage der menschlichen Sozialstruktur, der herausragenden Kooperativität und des außerordentlichen kulturellen Erfolges. Um diese Fähigkeit verstehen zu können, folgt die Forschung dem Konzept einer „Theory of Mind“ (ToM) und gliedert sie in eine affektive Komponente (Gefühle und Emotionen) und eine kognitive Komponente (Gedanken, Überzeugungen, Absichten). Einfluss haben zudem Gedächtnis- und visuelle Verarbeitungsfähigkeiten. Ihre Funktionsstörungen beeinträchtigen die sozialen Fähigkeiten entscheidend. 27
Die „soziale Intelligenz“ (Thorndike 1920, Humphrey 1984) ist durch ein geschärftes Bewusstsein für den Wert sozialer Beziehungen und die Fähigkeiten, eine andere Perspektive einzunehmen, weniger selbstfokussiert zu empfinden und zu handeln, mehr Aufmerksamkeit anderen Menschen zukommen zu lassen, sowie sich in befriedigenden Beziehungen zu engagieren, gekennzeichnet. 28
Die soziale Intelligenz ist abhängig von der emotionalen Intelligenz, also der Fähigkeit, eigene Emotionen und die Emotionen anderer wahrzunehmen und sich von ihnen im Verhalten leiten zu lassen. Die Erkennung der Emotionen anderer Menschen ist wiederum von der Erkennung emotionaler Gesichtsausdrücke abhängig, die offenbar unabhängig von der Fähigkeit der Gesichtserkennung ist. 29 30 Es werden Tests entwickelt, die soziale Intelligenz (ähnlich wie beim IQ) messbar machen. 31
Neurophysiologisch beruht die soziale Intelligenz auf einem Netzwerk neuronaler Regionen, die als „soziales Gehirn“ zusammengefasst werden. Dazu gehören der orbitofrontale Cortex (OFC), die obere Temporalwindung (superior temporal gyrus (STG) ) und der Mandelkern (Amygdala). Diese Regionen werden bei Sozialkontakten im fMRI aktiv; auch zeigen einige Regionen im präfrontalen Cortex Aktivität; sie sind beteiligt an kognitiven Fähigkeiten (s. o.). Menschen mit Autismus bzw. Asperger-Syndrom, die Defizite in Sozialkontakten aufweisen, zeigen dabei zwar eine Aktivierung der frontotemporalen Regionen, nicht dagegen der Amygdala. 32
Intelligenzentwicklung bei Teenagern
Untersuchungen zeigen, dass sowohl der verbale als auch der nonverbale IQ während des Teenageralters nicht, wie in anderen Lebensphasen, einigermaßen stabil bleibt, sondern ansteigen oder fallen kann. Dabei verändert sich der verbale IQ zugleich mit der grauen Substanz im Sprachzentrum. Der nonverbale IQ ändert sich zusammen mit der grauen Substanz in der Region der Fingeraktivierung. Beide IQ’s sind eng verknüpft mit der Fähigkeit zu lernen. Daraus wird abgeleitet: „This would be encouraging to those whose intellectual potential may improve; and a warning that early achievers may not maintain their potential.” (d. h. ein hoher IQ im Kindesalter kann sich im Adoleszentenalter bei mangelnden Lernanstrengungen verlieren; umgekehrt kann eine mangelnde IQ-Förderung im Kindesalter im Adoleszentenalter durch Lernen wieder wettgemacht werden). 12 33
Teilaspekt: räumliches Vorstellungsvermögen
Intelligenz wird mit räumlichem Vorstellungsvermögen in Verbindung gebracht: Wie passen zwei Gegenstände (bei Kindern Bauklötze o. ä.) zusammen, wie lässt sich ein Kofferraum am besten packen … In dieser Hinsicht schneiden im Allgemeinen Männer besser ab als Frauen.
Die räumliche Urteilsfähigkeit wird als unabhängig von der allgemeinen Intelligenz angesehen. 34 35 Dies wird mit einer etwas unterschiedlichen Hirnstruktur in Zusammenhang gesehen: im Parietallappen findet sich bei Männern die weiße Substanz (verantwortlich für neuronale Fernverbindungen) etwas vermehrt, bei Frauen dagegen die graue Substanz (Hirnzellen mit ihren Nahverbindungen). Unterschiede, die das räumliche Vorstellungsvermögen betreffen, wurden auch am Hippocampus festgestellt: Männer hatten einen größeren vorderen Hippocampus, Frauen dagegen einen größeren hinteren Hippocampus. Das Volumen der grauen Substanz des rechten vorderen Hippocampus korrelierte signifikant mit der Fähigkeit sich Gegenstände gedreht vorzustellen (3D-Mental-Rotation-Score). 36
Bei einer Rotationsaufgabe (z. B. zeigen zwei Bilder eines gedrehten Gegenstandes den selben Gegenstand?) zeigten Männer in einer Untersuchung eine schnellere Reaktionszeit als Frauen. 37 Aufgaben zur Rotation eines visuell erfassten Körpers werden auch von Jungen schneller und richtiger analysiert als von Mädchen. Mit dieser Fähigkeit hing auch eine bessere mathematische Performance zusammen. Die räumliche Verarbeitung spielt damit eine Rolle bei der mathematischen Leistung. Dies sollte Auswirkungen auf die Schulpraxis haben, wo räumliches Denken besser trainiert werden müsste. 38 Rotationsaufgaben werden sogar bereits im Säuglingsalter unterschiedlich gelöst. 39 Eine angeborene Komponente scheint nicht ausgeschlassen zu sein.
Intelligenz und Religiosität
Das Verhältnis von Intelligenz zu Religiosität hat seit langer Zeit großes Interesse geweckt. 40 Die Mehrheit der Studien zeigt, dass beide schwach negativ miteinander korreliert sind. Als Grund wird vermutet, dass intelligentere Menschen eher darin geübt sind, Probleme nicht über einen Glauben, sondern analytisch in den Griff zu bekommen. 41 Die insgesamt geringen Effekte waren in den Studien bei Verwendung von psychometrischen Tests ausgeprägter als von Notendurchschnitten. Die Studienauswertungen stehen im Einklang mit der Annahme, dass Menschen mit einer mehr erfahrungsorientierten und weniger analytischen Herangehensweise an Probleme für religiöse Inhalte empfänglicher sind. 42
→ Auf facebook informieren wir Sie über Neues und Interessantes!
→ Verwalten Sie Ihre Laborwerte mit der Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion.
Verweise
- Das Gehirn
- Bewusstsein und Gehirn
- Emotionen und Gehirn
- Spiritualität, Religiosität und Gehirn
- Musik und Gehirn
Weiteres
- Dialogues Clin Neurosci. 2012 Mar; 14(1): 19–27[↩][↩][↩]
- Dialogues Clin Neurosci. 2010;12(4):489-501[↩][↩]
- Front Syst Neurosci. 2022 Apr 12;15:787139. DOI: 10.3389/fnsys.2021.787139.[↩]
- Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2016 Jan 5;371(1685):20150180. DOI: 10.1098/rstb.2015.0180.[↩]
- Prog Brain Res. 2012;195:413-30. doi: 10.1016/B978-0-444-53860-4.00020-9.[↩]
- Prog Brain Res. 2012;195:443-59. doi: 10.1016/B978-0-444-53860-4.00022-2.[↩]
- Nat Commun. 2020 Oct 6;11(1):4937. DOI: 10.1038/s41467-020-18780-3. [↩]
- Br J Dev Psychol. 2019 Mar;37(1):101-111. DOI: 10.1111/bjdp.12261. Epub 2018 Aug 19. PMID: 30125367; PMCID: PMC6492004.[↩]
- Neuroimage. 2019 Oct 1;199:172-183. doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.05.076. Epub 2019 May 30. PMID: 31154047.[↩]
- Cell. 2021 Jul 27:S0092-8674(21)00836-9. DOI: 10.1016/j.cell.2021.07.010. Epub ahead of print. PMID: 34348112.[↩]
- Jared Diamond: Arm und Reich, die Schicksale menschlicher Gesellschaften, Fischer Verlag, erweiterte Neuausgabe 2006[↩]
- Nature. Oct 19, 2011; 479(7371): 113–116[↩][↩]
- Dev Cogn Neurosci. 2013 Jul;5:172-84[↩]
- Brain 2012: 135; 1154–1164[↩][↩]
- Gardner H. Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice. New York, NY: Basic Books; 2006[↩]
- Mol Psychiatry. 2011 Oct; 16(10):996-1005[↩]
- Mandelman SD., Grigorenko EL. Intelligence: genes, environments, and their interactions. In: Sternberg RJ, Kaufman, SB eds. Cambridge Handbook of intelligence. New York, NY: Cambridge University Press; 2011:85–106[↩]
- Behav Brain Sci. 2007 Apr; 30(2):135-54[↩]
- PLoS One. 2014 Feb 26;9(2):e88733. doi: 10.1371/journal.pone.0088733. [↩]
- Arch Gen Psychiatry. 2006 Jul;63(7):731-40[↩]
- PLoS One. 2011;6(11):e27389. doi: 10.1371[↩]
- Isr J Psychiatry Relat Sci. 2012;49(2):137-42[↩]
- Neuroimage. 2014 Oct 15;100:676-83. doi: 10.1016/j.neuroimage.2014.04.072. Epub 2014 May 9. PMID: 24816534.[↩]
- Brain 2012: 135; 1154–64[↩]
- Brain. 2012 Apr;135(Pt 4):1154-64[↩]
- Neuroimage. Mar 2014; 88(100): 125–133[↩]
- Neuropsychiatr Dis Treat. 2019 Feb 20;15:557-573. doi: 10.2147/NDT.S158996.[↩]
- PLoS One. 2015 Jun 15;10(6):e0128638. doi: 10.1371/journal.pone.0128638.[↩]
- Front Hum Neurosci. 2014 Dec 3;8:974. doi: 10.3389/fnhum.2014.00974. eCollection 2014[↩]
- Front Psychol. 2015 Jun 9;6:770. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00770[↩]
- PLoS One. 2015 Jun 15;10(6):e0128638. doi: 10.1371/journal.pone.0128638[↩]
- Eur J Neurosci. 1999 Jun;11(6):1891-8[↩]
- Nature. 2012 May 16; 485(7400): 666[↩]
- J Cogn Neurosci . 2010 Jan;22(1):139-55. DOI: 10.1162/jocn.2008.21175 .[↩]
- Brain Cogn . 2009 Apr;69(3):451-9. doi: 10.1016/j.bandc.2008.09.004[↩]
- Front Hum Neurosci . 2016 Nov 15;10:580. DOI: 10.3389/fnhum.2016.00580 [↩]
- Dev Neuropsychol . 2000;17(2):199-223. DOI: 10.1207/S15326942DN1702_04 [↩]
- Front Psychol. 2019 Jan 30;10:107. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00107[↩]
- Front Psychol. 2024 Sep 13;15:1415651. doi: 10.3389/fpsyg.2024.1415651[↩]
- Howells, Thomas H. „A comparative study of those who accept as against those who reject religious authority.“ University of Iowa Studies: Studies in Character (1928).[↩]
- Pers Soc Psychol Bull. 2020 Jun;46(6):856-868. DOI: 10.1177/0146167219879122 [↩]
- PLoS One. 2022 Feb 11;17(2):e0262699. DOI: 10.1371/journal.pone.0262699.[↩]