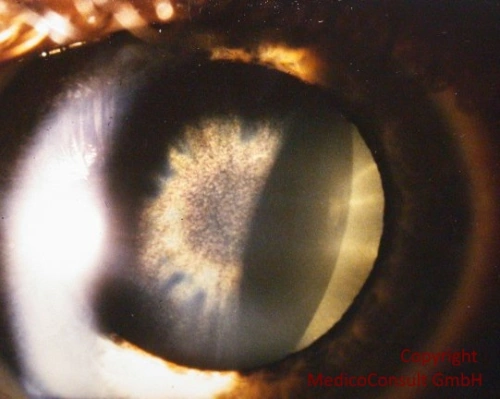Die Therapie des Morbus Wilson sollte so früh wie möglich beginnen, möglichst noch vor Einsetzen neurologischer Symptome.
Allgemeines zur Wilson-Therapie
Die Behandlung basiert grundsätzlich auf diätetischen und medikamentösen Maßnahmen:
- Entfernung überschüssigen Kupfers aus dem Körper mit Chelatbildnern wie D-Penicillamin oder Trientin und
- Hemmung der Kupferaufnahme aus dem Darm durch Zinksalze,
- Reduktion einer eventuell erhöhter Kupferbelastung durch Trinkwasser oder Ernährung,
Wenn die Lebererkrankung weit fortgeschritten ist und eine behindernde neurologische Symptomatik eingesetzt hat, kommt eine Lebertransplantation in Betracht. Sie ist im Fall einer akuten Leberdystrophie (Wilson-Krise) oder einer Leberzirrhose im Endstadium die wichtigste Option (s. u.).
Unter langfristiger Behandlung können sich neurologische Symptome rückläufig entwickeln. Ein krankheitsassoziierter Hypopituitarismus (Hypophysenunterfunktion) mit seinen hormonellen Ausfallsymptomen (inkl. Unterfunktion der Schilddrüsen und der Gonaden) kann sich bessern. 1 2
→ Morbus Wilson
→ Wilson-Krise
→ Kupferstoffwechsel
Diät
Grundlage der Therapie ist eine kupferarme Diät. Ein gesunder Erwachsener braucht eine tägliche Zufuhr von 0,5 – 2 mg Kupfer. Alleine Trinkwasser kann bis 0,2 mg/l Kupfer enthalten. Daher wird empfohlen, bei der Anbehandlung geprüft reines Wasser zu verwenden. 3
Kupferreiche Nahrungsmittel: Zu vermeiden sind kupferreiche Nahrungsmittel, vor allem Schokolade, Trockenfrüchte, Tierleber, Pilze, Nüsse, Mehrkornbrot und Schalentiere. Austern beispielsweise enthalten 16 mg pro kg und Schafleber 157 mg pro kg Kupfer. Auch rote Bohnen und schwarze Bohnen enthalten sehr viel Kupfer.
Kupferarme Lebensmittel: Der Kupfergehalt von Sojabohnen und Tofu dagegen ist nicht hoch, ebenso der von poliertem Reis, Weißmehl, helles Gemüse, Obst, magerem Fleisch, Geflügelfleisch, Eier und Süßwasserfisch mit niedrigem Kupfergehalt. 4
Diätetische Beratung: Sie ist unabdingbar.
Medikamente
Folgende Medikamente werden bei der Behandlung des Morbus Wilson verwendet: 5 (Dosierungsangaben dürfen nicht ungeprüft übernommen werden!)
D-Penicillamin
D-Penicillamin ist ein Mittel, das Kupfer komplexiert (Chelatbildner) und damit löslich und ausscheidungsfähig macht. Es wirkt über eine Erhöhung der Kupferausscheidung im Urin.
Nebenwirkungen: Eine Reihe von Nebenwirkungen sind zu beachten. Dazu gehören toxische und allergisch-hypererge Reaktionen, Wundheilungsstörungen, Anti-Vitamin-B6-Wirkung, Verschlechterung der (besonders neurologischen) Symptome zu Beginn der Therapie (bei 10 – 20 % der Erkrankten).
Dosierung (Dosierungen müssen überprüft und individuell angepasst werden): zu Beginn 20 – 30 mg/kg KG/Tag in drei Einzeldosen vor den Mahlzeiten; nach Besserung: 10 – 15 mg/kg KG/Tag; Dauermedikation (meist nach 4 – 6 Monaten, wenn die 24-Stunden-Kupferausscheidung unter 500 µg gesunken ist): 7,5 mg/kg KG/Tag; bei bestehender Schwangerschaft: 5 – 7,5 mg/kg KG/Tag.
Regelmäßige Kontrollen: Am praktikabelsten ist die Kupferausscheidung im Urin.
Vitamin-B6-Mangel: Zur Therapie des manchmal symptomatischen Vitamin-B6-Mangels werden25 mg/d Pyridoxin empfohlen.
→ Medikamente bei Leberkrankheiten
Trientine
Trientine ist ebenfalls ein Chelatbildner, der die Kupferausscheidung über den Urin erhöht.
Indikation: Unverträglichkeit von d-Penicillamin.
Nebenwirkungen: ähnlich denen des Penicillamins, aber seltener (auf Eisenmangel achten!).
Dosierung: zu Beginn: 3 x 600 mg/Tag; bei Besserung: 2 x 600 mg/Tag
Regelmäßige Kontrollen der Kupferausscheidung im Urin.
Zink
Zink wirkt über eine Hemmung der Kupferaufnahme im Darm.
Indikationen: Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Kupferbilanz nach anfänglicher Kupferausschwemmung mit D-Penicillamin; Indikation auch bei präsymptomatischen Patienten (keine klinischen Symptome durch Leberzirrhose oder Beteiligung des zentralen Nervensystems), sowie bei bestehender Schwangerschaft. Nebenwirkungen sind nicht bekannt.
Dosierung: 3 mg/kg KG/Tag verteilt auf drei Einzeldosen; verträglicher sind Zinkazetat, Zinkorotat oder Zinkhistidin.
Urinkontrollen.
Lebertransplantation
Eine Lebertransplantation führt zur definitiven Heilung. Als Indikationen kommen infrage: das akute Leberversagen, die dekompensierte Leberzirrhose und eine wegen Nebenwirkungen nicht durchführbare medikamentöse Therapie.
Eine frühzeitige Lebertransplantation mit einer Lebendspende hat Vorteile; in einer Studie waren nach 5 Jahren 100 % der frühzeitig Transplantierten am Leben geblieben.
Bei einer akuten Wilson-Krise kann eine Hämofiltration (Blutwäsche) und ein Plasmaaustausch die Zeit bis zur Transplantation überbrücken helfen. 6
Der Erfolg einer Lebertransplantation bei Kindern wird als sehr gut eingeschätzt. In einer Auswertung von 6 Studien mit 290 Kindern lag die durchschnittliche 1-Jahres-Überlebensrate bei 91,9 %, die einer 5-Jahres-Überlebensrate bei 88,2 %. Eine Verschlechterung mit Notwendigkeit einer erneuten Transplantation wurde bei 16 Patienten (Transplantationsabstoßung) durchgeführt 7.
Prognose
Bei Beginn der Therapie im Frühstadium der Erkrankung ist die Lebenserwartung nicht eingeschränkt. In späteren Stadien bei schon bestehenden irreversiblen Schäden kann die Progredienz der Erkrankung durch die Therapie aufgehalten werden. 8
Neue Entwicklungen
Es zeichnen sich Fortschritte in der Behandlung der Wilson-Krankheit durch eine Gentherapie und durch Stammzellen ab. 9 10 11 12
Stammzelltherapie: Eine Stammzelltherapie korrigiert prinzipiell den genetischen Defekt (ebenso wie eine Lebertransplantation, s. o.). Sie ist Gegenstand der Forschung. 13 Es wurde gezeigt, dass die Behandlung einer jungen Frau mit Amnionflüssigkeit (Fruchtwasser), welche mit genetisch gesunden Stammzellen angereichert war, zu einer deutlichen Verbesserung der Symptome inkl. einem Rückgang der Hirnläsionen führte. Dazu waren 12 Fruchtwasseranwendungen verschiedener schwangerer Frauen nötig. Studien sind zu erwarten. 14
Transplantation reprogrammierter Leberzellen: Eine Alternative ist die Transplantation von in vitro ATP7B-reprogrammierter Hepatozyten in den Körper, deren anhaltender Effekt experimentell bei ATP7B-Mangel-Mäusen bereits gezeigt werden konnte 15.
Gentherapie: Das Prinzip beruht auf der zielgerichteten Einbringung des gesunden Gens (Kupfer-transportierende P-type ATPase, Atp7b) über einen Vektor (ein Virus, welches die Leberzellen ansteuert) in das Blut des Wilson-Kranken. 16 Die Behandlungsmethode wurde im Tierversuch getestet; die behandelten Kupfer-speichernden Ratten zeigten eine deutliche Reduktion der Leberveränderungen und keine Vernarbung. Die Autoren propagieren eine frühzeitige gentherapeutische Behandlung für betroffene Menschen. 17 18 19
→ Auf facebook informieren wir Sie über Neues und Interessantes!
→ Verwalten Sie Ihre Laborwerte mit der Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion.
Verweise
- Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2021 Jan 11;2021:20-0086. DOI: 10.1530/EDM-20-0086[↩]
- J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Feb;66(2):334-344. doi: 10.1097/MPG.0000000000001787.[↩]
- Front Cell Dev Biol. 2022 Dec 21;10:1091580. DOI: 10.3389/fcell.2022.1091580[↩]
- Front Cell Dev Biol. 2022 Dec 21;10:1091580. DOI: 10.3389/fcell.2022.1091580[↩]
- Sci Prog. 2013;96(Pt 1):19-32[↩]
- Intern Med. 2003 Oct;42(10):967-70. doi: 10.2169/internalmedicine.42.967.[↩]
- Transplant Proc. 2019 Mar;51(2):443-445. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.017[↩]
- Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2022 Feb-Mar;56-57:101768. doi: 10.1016/j.bpg.2021.101768[↩]
- World J Hepatol. 2021 Jun 27;13(6):634-649. DOI: 10.4254/wjh.v13.i6.634 .[↩]
- Appl Clin Genet. 2017 Jan 13;10:9-19. doi: 10.2147/TACG.S79121. eCollection[↩]
- Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2021 Jan 20;29(1):21-24. Chinese. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20201104-00598.[↩]
- Hum Gene Ther. 2019 Dec;30(12):1494-1504. DOI: 10.1089/hum.2019.148[↩]
- Curr Stem Cell Res Ther. 2022;17(8):712-719. doi: 10.2174/1574888X16666211006111556[↩]
- Front Med (Lausanne). 2024 Feb 14;11:1297457. doi: 10.3389/fmed.2024.1297457.[↩]
- Hepatology. 2022 Oct;76(4):1046-1057[↩]
- Nat. Rev. Drug Discov. 2019; 18, 358–378[↩]
- Hum Gene Ther Clin Dev. 2019 Mar;30(1):29-39. DOI: 10.1089/humc.2018.219[↩]
- Mol Ther Methods Clin Dev. 2022 Oct 21;27:293-294[↩]
- JHEP Rep. 2021 Oct 30;4(1):100389. doi: 10.1016/j.jhepr.2021.100389[↩]